|
|
Jörgen
Beckmann
Vergleich
der Kornmaße im Herzogtum Kleve und in der Grafschaft Mark
sowie in angrenzenden Handelsorten mit dem Berliner Maß im
Jahre 1714 und 1725
(aus
„HEVEN - einst und jetzt“, Heft 16, Witten 2003)
Für uns ist es
heute selbstverständlich, in fast ganz Europa einheitliche
Maßsysteme vorzufinden. Seit dem 1.Januar 2002 besitzen wir
Westeuropäer sogar eine gemeinsame Währung, und zwar den Euro
als offizielles Zahlungsmittel. Sicher gibt es auch in Europa
bezogen auf gemeinsame Maß- und Währungssysteme noch
Ausnahmen, wobei ich als Beispiel Großbritannien anführen
möchte.
Einheitliche
Maßsysteme und Normen sind jedoch die Voraussetzungen für das
Funktionieren einer länderübergreifenden Marktwirtschaft, die
letztlich größeren Wohlstand für alle Beteiligten bedeutet.
Für uns ist heute das Meter das standardisierte Längenmaß. Es
wurde 1791 in Paris als der 40-millionste Teil des Erdumfanges
definiert und im Jahre 1875 durch die „internationale
Meter-Convention“ gemäß eines festgelegten vierkantigen
Prototyps aus Platin und Iridium zum allgemeinen Längenmaß
erklärt.
Doch seit wann
brauchte der Mensch Maße?
Als sich die
Menschen zu organisierten Rechtsgemeinschaften zusammenschlossen
und mit Beginn des Ackerbaus seßhaft wurden, mussten sie zur
dauernden Existenzsicherung die zur Verfügung stehenden
Flächen gegeneinander abgrenzen und folglich einmessen. Als
Maß benutzten sie dazu standardisierte Körpermaße wie Elle,
Spanne, Handbreite, Fuß und Schritt. Da anfänglich ihr
Wirtschaftraum nahezu nur auf die eigene Siedlung beschränkt
war, entwickelte fast jede Gemeinde trotz gleicher Bezeichnung
voneinander abweichende Längen-, Flächen- und Hohlmaße. Mit
der zu Beginn des 18. Jahrhunderts erfolgten Ausweitung der
Wirtschaft und des Handels erwiesen sich die regional
unterschiedlichen Maße als unpraktisch und hinderlich.
So ist es zu
verstehen, dass der Preußische König Friedrich Wilhelm 1714
darauf drang, in den seit 1609 zu Preußen gehörenden Gebieten
wie dem Herzogtum Kleve und der Grafschaft Mark endlich
einheitlich das Berliner Maß einzuführen. Jacobus von Wesel
war einer der ersten, der im Jahre 1714 eine 26-seitige
Umrechnungstabelle5 für die Verwaltung und das Militär
sowie für den Handel zusammenstellte und veröffentlichte.
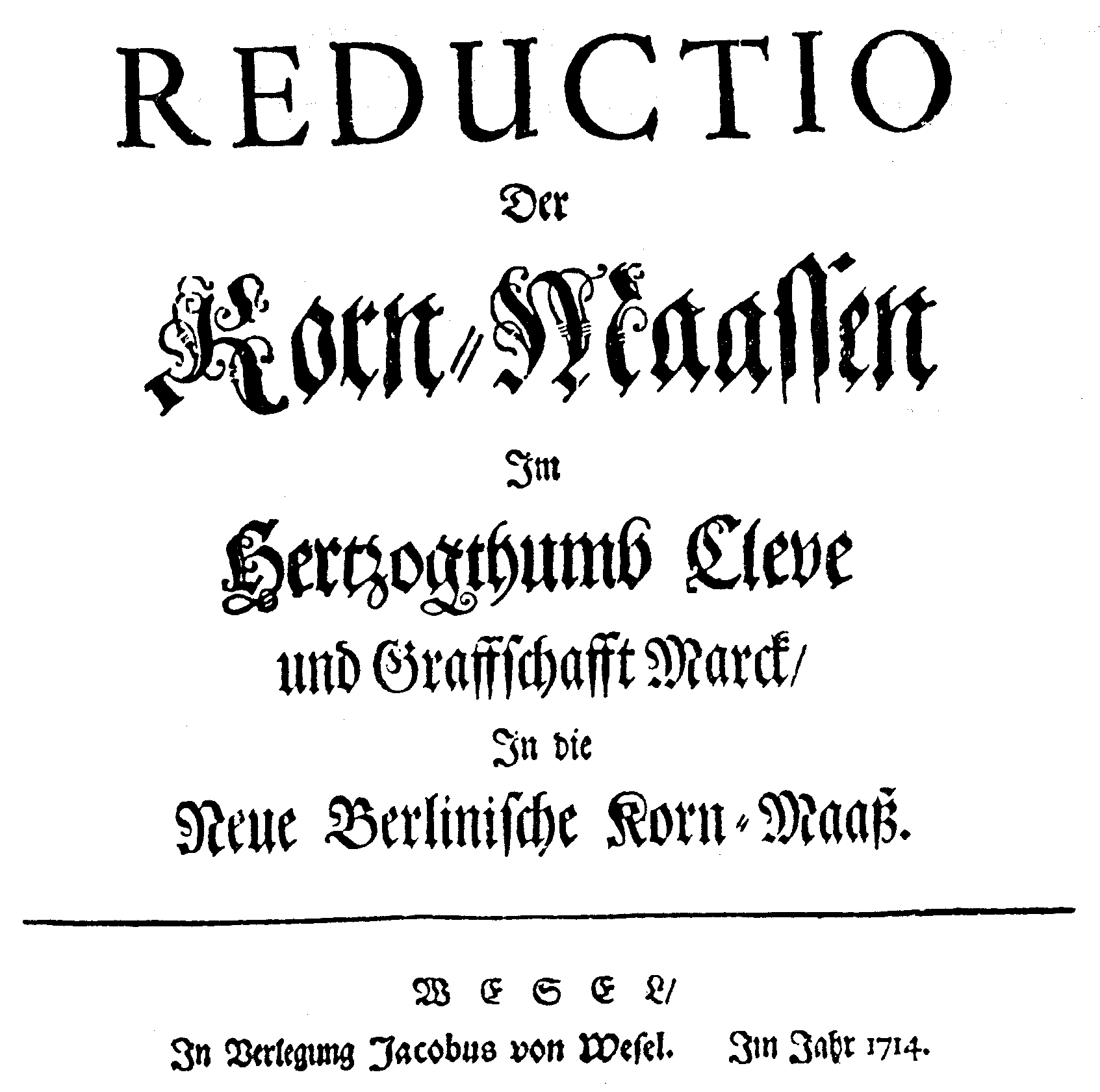
Aus
diesen tabellarischen Auflistungen, von denen hier vier mit
Maßen der uns am nächsten anliegenden Orte abgedruckt sind,
entnahm ich die Werte für folgende Zusammenfassung und
bestimmte das jeweilige Volumen pro Malter bezogen auf einen
Berliner Malter mit 219,856 Liter bzw. dm³.
11
Jahre später wurde dann eine weitere halbwegs brauchbare
Umrechnungstabelle, die Jacob de Vries zusammengestellt hatte,
von der Königlich preußischen Kriegs- und Domainen-Kammer in
Kleve aufgegriffen und im hiesigen Gesetzes- und
Verordnungsblatt am 12.Januar 1725 veröffentlicht.
Die
folgende von mir aus beiden Veröffentlichungen
zusammengestellte Tabelle läßt deutlich erkennen, dass nahezu
jeder größere Ort im hiesigen Raum ein eigenes Hohlmaßsystem
besaß. Während Jacobus von Wesel sich fast ausschließlich nur
auf Orte im klevischen und märkischen Raum beschränkte, nannte
Jacob de Vries zusätzlich auch Ortmaße und Maßverhältnisse
aus den angrenzenden niederländischen, bergischen, Kölner und
Dortmunder Gebieten. Die Doppelnennung einiger Orte in folgender
Tabelle ist darin begründet, daß Jacobus von Wesel und Jacob
de Vries diese Orte in unterschiedliche Gruppen gliederten.
Auffallend
ist, dass de Vries zur Verhältnisfindung weitgehend als Divisor
die Werte 2, 3, 7, 8, 14, 28, 56, 112 und 336 benutzte, wobei
die meisten Zahlen ein Vielfaches von 7 sind. Anhand der
zusätzlichen genannten Querverweise wie z.B. die
Malterverhältnisse bei Bochum zu Dortmund und Unna zu Hamm bzw.
zu Köln wird deutlich, dass diese Umrechnungen noch erhebliche
Ungenauigkeiten zeigten. So entsprechen 4 Malter zu Hamm 5
Malter zu Unna, 15 Malter zu Unna 14 Berliner Malter und 25
Malter zu Hamm 28 Berliner Malter; ersetzt man die 15 Malter zu
Unna durch die gleiche Menge, also durch 12 Malter zu Hamm, so
entspräche dieses einem Mengenverhältnis zum Berliner Maß von
24 zu 28 und nicht von 25 zu 28. Bei dem Ort Goch scheint das
von de Vries angegebene Verhältnis von 37:28 nicht zu stimmen,
es müsste 39:28 lauten.
Normalerweise
galt das Streichmaß, d.h. das gefüllte Maßgefäß wurde über
der Oberkante abgestrichen. Einzig für Hafer wurde das
gehäufte Maß (Haufmaß) angewandt. Hierbei wurde das
Maßgefäß solange angefüllt, bis der Hafer über den Rand
rieselte.
Bei
Jacobus von Wesel (1714) und Jacob de Vries (1725) galten
folgende Berliner Korn- und Hohlmaßverhältnisse:
|
Berliner
Korn- bzw. Hohlmaß |
nach
Jacobus von Wesel (1714) |
nach
Jacob de Vries (1725) |
|
1
Last |
|
14
Malter = 3078 Liter |
|
1
Malter = 219,856 Liter |
=
4 Scheffel |
=
4 Scheffel |
|
1
Scheffel = 54,964 Liter |
=
4 Viertel |
=
4 Spint |
|
1
Viertel = 13,741 Liter |
=
11 ½ Kannen |
|
|
1
Spint = 13,741 Liter |
=
11 ½ Kannen |
=
11 ¾ Kannen |
|
1
Metze |
=
2 7/8 Kannen = ¼ Spint |
|
|
1
Kanne |
=
16 Mäßger |
=
16 Mäßger |
|
1
Ohm |
|
=
120 Kannen |
Die
folgende Tabelle vergleicht die Werte von Jacobus von Wesel
(1714) und Jacob de Vries (1725), wobei die nur 1725 genannten
Orte mit einem Sternchen „ * “ gekennzeichnet sind. Die in
Klammern gestellten Werte ergeben sich aus sekundär
angeführten Orts zu Orts-Verhältnissen. Die jeweils oben in
der Zeile genannte Größe bzw. Zahl der 5. und 6. Spalte von
links gilt für alle darunter genannten Orte, wohingegen die
tiefer gestellte Zahl in einer Zeile sich nur auf den
entsprechenden Ort bezieht.
|
|
|
nach
Jacobus von Wesel |
|
nach
Jacob de Vries |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
5. |
6. |
7. |
|
G
r u p p e |
Ort |
1
Malter des Ortes ist in Berliner Maß im Jahre 1714 |
1
Malter des Ortes in Liter im Jahre 1714 |
|
Verhältnis
der Anzahl der Malter des Ortes zu Berliner Malter 1725* |
1
Malter des Ortes in Liter im Jahre 1725* |
Anzahl
der Malter des Ortes, die 1725* einer Berliner Last von
3078 Liter entsprachen |
|
1. |
Kleve
(Stadt, Amt*), Bimmen*, Budberg (Buddenberg)*,
Cleverhamm*, Duselt*, Dusselwarth* , Griethausen*,
Halt*, Huisberden*, Kamen*, Keeken*, Kranenburg (Stadt),
Lünen* |
3
Scheffel, 11 Kannen |
178,036 |
|
69:56 |
178,434 |
17
¼ |
|
2. |
Köln
(Stadt)* Wesel (Stadt, Amt*) Xanten* Rees*, Bislich*,
Boetzelaer*, Borth*, Brunen*, Büderich (Amt)*,
Büderich (Stadt) , Emmerich (Stadt), Gastrop*, Grieth
(Stadt), Groin*, Haldern*, Hamminkeln*, Hassen*, Hünre*,
Hurl*, Isselburg (Stadt), Kervenheim*, Krudenburg*,
Mehr*, Millingen*, Niedermörmter*, Ringenberg*,
Rinnenthal*, Schermbeck (Stadt), Sonsbeck*, Sonsfeld*,
Voerde*, Wehl*, Westerbruch* |
2
Scheffel, 3 Viertel, 8 Mäßger |
151,748 |
|
10:7 |
153,899
(152,110) |
20 |
|
3. |
Rheinberg* |
|
|
|
|
(173,136) |
|
|
4. |
Borken* |
|
|
|
|
(115,424) |
|
|
5. |
Dorsten* |
|
|
|
|
(230,849) |
|
|
6. |
Geldern* |
|
|
|
3:2 |
146,571 |
21 |
|
7. |
Appeldorn*
Kalkar (Stadt) Kervendonk* Sevenum (Stadt) Uedem (Stadt) |
2
Scheffel, 2 Viertel, 4 Kannen |
142,190 |
|
43:28 |
143,162 |
21
½ |
|
8. |
Beeck*
Duisburg (Stadt) Meiderich* Ruhrort (Freiheit) |
3
Scheffel, 1 Viertel, 5 Kannen, 8 Mäßger |
185,205 |
|
33:28 |
186,544 |
16
½ |
|
9. |
Sonsbeck
(Stadt) Xanten (Stadt) |
2
Scheffel, 2 Viertel, 11 Kannen |
150,554 |
|
|
|
|
|
10. |
Goch
(Stadt) Kessel (Jurisdiction)* Weeze* |
2
Scheffel, 3 Viertel, 4 Kannen, 8 Mäßger |
156,528 |
|
37:28
? (39:28) |
166,376
? (157,845) |
19
½ |
|
11. |
Kessel
(Amt)* Venlo* Strahlen* (Straelen) Roemond* Weizen*
Roggen* Gerste, Hafer* |
|
|
|
4:3
451:336 59:42 147:112 |
164,892
163,795 156,508 167,509 |
18
2/3 18 19/24 19 2/3 18 3/8 |
|
12. |
Nimwegen*
Lobith* Mook* |
|
|
|
9:7 |
170,999 |
18 |
|
13. |
Lobberich* |
|
|
|
123:112 |
200,194 |
15
3/8 |
|
14. |
Orsoy
(Stadt) Sterkrade* Dinslaken* |
3
Scheffel, 1 Viertel, 2 Kannen, 8 Mäßger |
181,620 |
|
65:56 |
189,414 |
16
¼ |
|
15. |
Dinslaken
(Stadt) |
3
Scheffel, 1 Viertel, 8 Kannen, 8 Mäßger |
188,789 |
|
65:56 |
189,414 |
16
¼ |
|
16. |
Gennep
(Stadt) Kervenheim* Uedem (Amt)* Heyen* |
2
Scheffel, 2 Viertel, 8 Kannen |
146,969 |
|
85:56 |
144,846 |
21
¼ |
|
17. |
Kranenburg
(Schlutern oder Burgscheffel) |
2
Scheffel, 3 Viertel, 7 Kannen, 8 Mäßger |
160,113 |
|
|
|
|
|
18. |
Arnheim*
Huissen |
2
Scheffel, 2 Viertel, 1 Kannen |
138,605 |
|
11:7 |
139,908 |
22 |
|
19. |
Holten
(Stadt) |
3
Scheffel, 9 Kannen |
175,646 |
|
17:14 |
181,058 |
17 |
|
20. |
Holtige
Burgscheffel |
3
Scheffel, 6 Kannen |
172,061 |
|
|
|
|
|
21. |
Hamm
(Stadt) |
1
Malter, (2 Kannen) |
219,856
(222,246) |
|
25:28 |
246,239 |
12
½ |
|
22. |
Unna* |
|
|
|
15:14 |
205,199 |
15 |
|
23. |
Hagen
(Gericht) Kamen (Stadt) Unna (Stadt) Westhofen
(Freiheit) Schwerte* (Niederamt) |
3
Scheffel, 1 Viertel, 4 Kannen, 8 Mäßger |
184,010 |
|
|
(205,199)
(177,756) (177,756) |
|
|
24. |
Iserlohn
(Stadt) |
1
Malter, 3 Viertel, 8 Mäßger |
261,676 |
|
|
|
|
|
25. |
Schwelm
Schwerte (Stadt, Oberamt*) Wetter (Freiheit) |
3
Scheffel, 10 Kannen |
176,841 |
|
11:8 |
(173,078)
159,895 |
19
¼ |
|
26. |
Lünen
(Stadt) |
3
Scheffel, 7 Kannen |
173,256 |
|
|
178,434 |
|
|
27. |
Blankenstein
Bochum Bruch* Castrop Eickel* Hattingen* Herbede*
(Heven)* Herne Horst* Langendreer* Stiepel* Strünkede*
Volmarstein Wattenscheid |
3
Scheffel, 1 Viertel, 7 Kannen, 8 Mäßger |
187,595 |
|
8:7 |
192,374 |
16 |
|
28. |
Dortmund*
Castrop* Mengede* |
|
|
|
64:49 |
(168,327)
158,940 |
|
|
29. |
Hörde
(Freiheit) |
3
Scheffel |
164,892 |
|
|
(158,608) |
|
|
30. |
Plettenberg
(Stadt) |
1
Malter, 9 Kannen |
230,610 |
|
|
|
|
|
31. |
Altena
(Freiheit) Altena (Stadt)* Wiblingwerde* Kelleramt* |
3
Scheffel, 3 Viertel, 4 Kannen, 8 Mäßger |
211,492 |
|
|
(273,599) |
|
|
32. |
Lüdenscheid
(Stadt) Werden (Stadt) |
3
Scheffel, 2 Viertel |
192,374 |
|
|
|
|
|
33. |
Breckerfeld
(Stadt) |
3
Scheffel, 1 Viertel, 5 Kannen, 8 Mäßger |
185,205 |
|
|
|
|
|
34. |
Soest
(Stadt) |
1
Malter, 1 Viertel, 8 Mäßger |
234,194 |
|
2:7 |
769,496 |
4 |
|
35. |
Lippstadt* |
|
|
|
1:4 |
879,424 |
|
Jacob de Vries
erwähnt 1725 auch noch das Längenmaß Elle, das Hohlmaß Ohm
(nasse Maß) und das Gewicht. Er führt dazu Folgendes an:
Im
Herzogtum Kleve und in der Grafschaft Mark sowie in den
angrenzenden Provinzen war die „Brabandische und Kölnische
Elle“ durchgehend üblich. Das Verhältnis derselben zur
Berlinischen Elle ist folgendes:
|
1
Berliner Elle = 0,667 m |
|
|
32
Brabandische Ellen |
=
33 Berlinische Ellen |
|
1
Brabandische Elle = 0,688 m |
|
|
25
Kölnische Ellen |
=
22 Berlinische Ellen |
|
1
Kölnische Elle = 0587 m |
|
|
|
|
|
1
Berliner Ohm = 140,328 Liter |
=
120 Berliner Kannen |
|
1
Berliner Kanne = 1,169 Liter |
|
|
1
Klever Ohm = 146,766 Liter |
=
112 Klever Kannen = 125,5 Berliner Kannen |
|
1
Klever Kanne = 1,310 Liter |
|
|
1
Kölner Ohm = 146,766 Liter |
=
108 Kölner Kannen = 125,5 Berliner Kannen |
|
1
Kölner Kanne = 1,359 Liter |
|
|
1
Geldernsche Kanne = 1,754 Liter |
=
1,5 Berliner Kannen |
Im
Kleve-Märkischen (Geldern’schen), Kölnischen und
Nachbarlanden ist das alte Gewicht mit dem Berlinischen
gewöhnlichen Krämergewicht vollkommen gleich, das Berliner
Fleischgewicht ist aber um 10 pCt. (%), und das Berliner
Fischgewicht um 25 pCt.(%) schwerer als das Berliner
Krämergewicht.
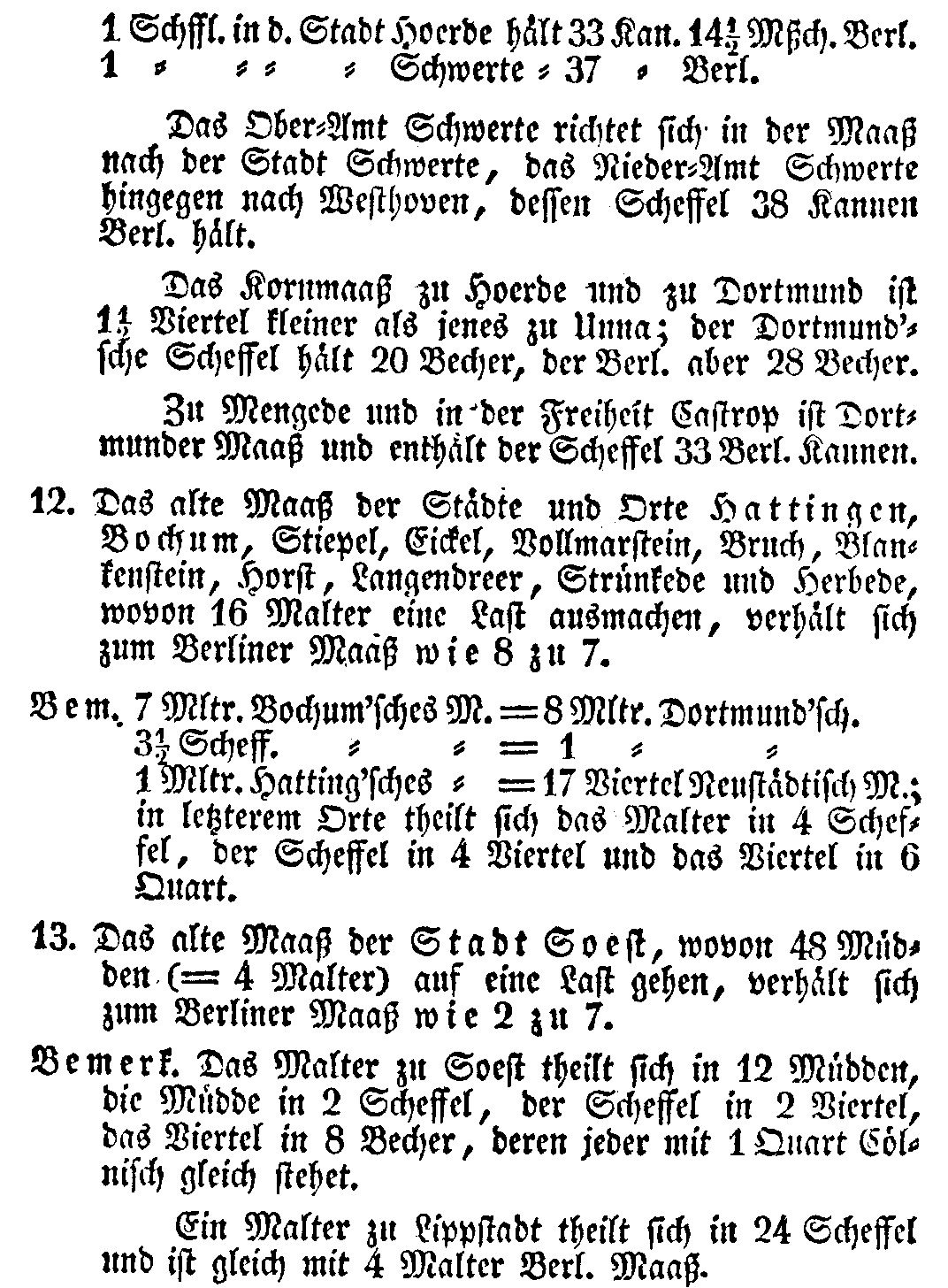
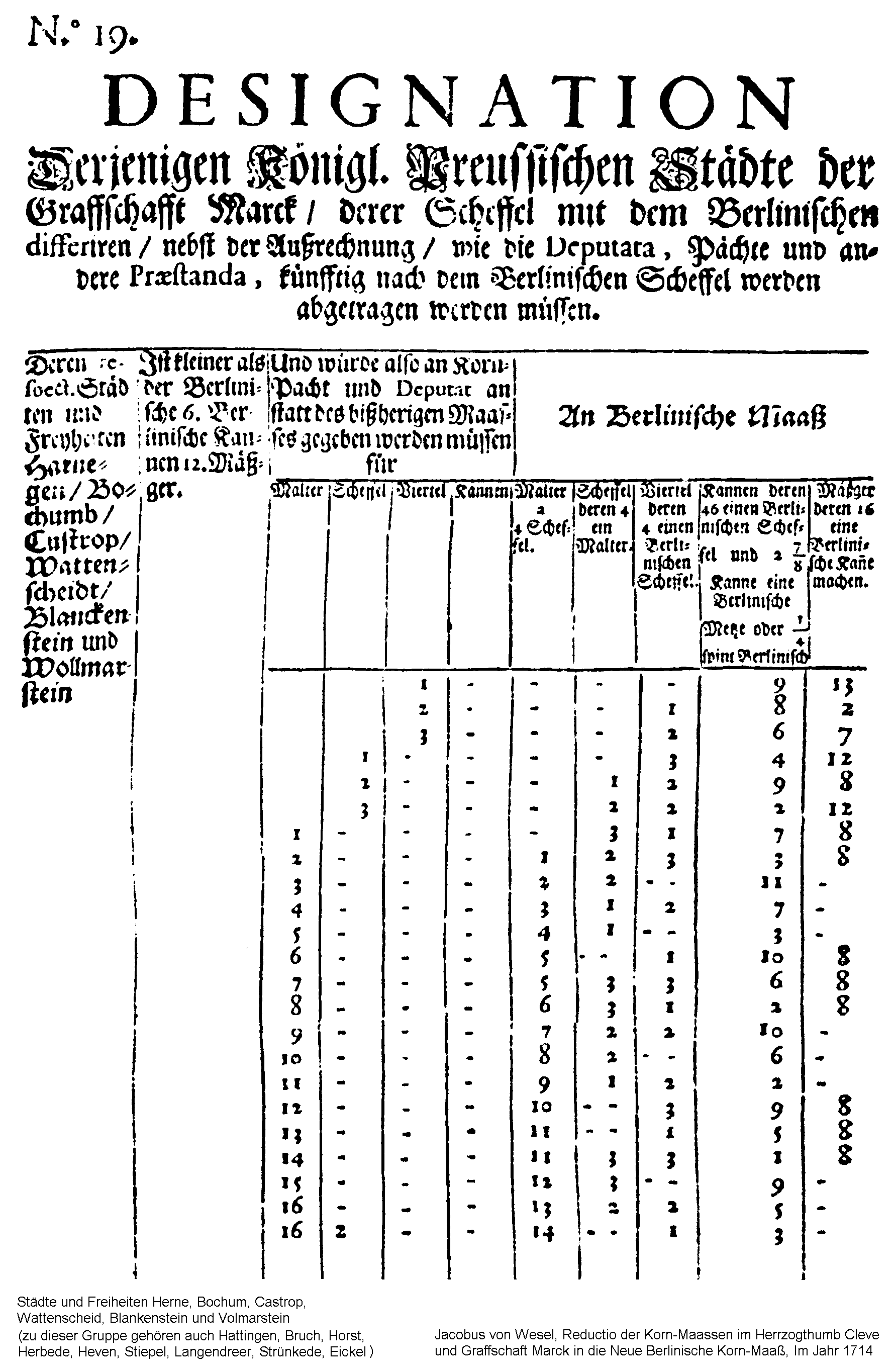
|
Seite
15 Ortsmaß Stadt Unna, Camen, Freiheit Westhofen,
Gericht Hagen (Streichmaß) |
Berliner
Maß |
|
Malter |
Scheffel |
Viertel |
Kannen |
Malter |
Scheffel |
Viertel |
Kannen |
Mäßger |
|
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
9 |
10 |
|
|
|
2 |
- |
- |
- |
1 |
7 |
12 |
|
|
|
3 |
- |
- |
- |
2 |
5 |
14 |
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
3 |
4 |
- |
|
|
2 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
8 |
- |
|
|
3 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
8 |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
3 |
1 |
4 |
8 |
|
2 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
9 |
- |
|
3 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
2 |
- |
|
4 |
- |
- |
- |
3 |
1 |
1 |
6 |
8 |
|
5 |
- |
- |
- |
4 |
- |
2 |
11 |
- |
|
6 |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
4 |
- |
|
7 |
- |
- |
- |
5 |
3 |
1 |
8 |
8 |
|
8 |
- |
- |
- |
6 |
2 |
3 |
1 |
8 |
|
9 |
- |
- |
- |
7 |
2 |
- |
6 |
- |
|
10 |
- |
- |
- |
8 |
1 |
1 |
10 |
8 |
|
11 |
- |
- |
- |
9 |
- |
3 |
4 |
8 |
|
12 |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
8 |
- |
|
13 |
- |
- |
- |
10 |
3 |
2 |
1 |
- |
|
14 |
- |
- |
- |
11 |
2 |
3 |
5 |
8 |
|
15 |
- |
- |
- |
12 |
2 |
- |
10 |
- |
|
16 |
- |
- |
- |
13 |
1 |
2 |
3 |
- |
|
16 |
2 |
3 |
- |
13 |
3 |
3 |
5 |
6 |
|
Seite
17 Ortsmaß Stadt Schwerte, Freiheit Wetter, Schwelm
(Streichmaß) |
Berliner
Maß |
|
Malter |
Scheffel |
Viertel |
Kannen |
Malter |
Scheffel |
Viertel |
Kannen |
Mäßger |
|
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
9 |
4 |
|
|
|
2 |
- |
- |
- |
1 |
7 |
- |
|
|
|
3 |
- |
- |
- |
2 |
4 |
12 |
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
3 |
2 |
8 |
|
|
2 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
5 |
- |
|
|
3 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
7 |
8 |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
3 |
- |
10 |
- |
|
2 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
1 |
8 |
8 |
|
3 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
2 |
7 |
- |
|
4 |
- |
- |
- |
3 |
- |
3 |
5 |
8 |
|
5 |
- |
- |
- |
4 |
- |
- |
4 |
- |
|
6 |
- |
- |
- |
4 |
3 |
1 |
2 |
8 |
|
7 |
- |
- |
- |
5 |
2 |
2 |
7 |
- |
|
8 |
- |
- |
- |
6 |
1 |
1 |
11 |
- |
|
9 |
- |
- |
- |
7 |
- |
3 |
9 |
8 |
|
10 |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
8 |
- |
|
11 |
- |
- |
- |
8 |
3 |
1 |
6 |
8 |
|
12 |
- |
- |
- |
9 |
2 |
2 |
5 |
- |
|
13 |
- |
- |
- |
10 |
1 |
3 |
3 |
8 |
|
14 |
- |
- |
- |
11 |
1 |
- |
2 |
- |
|
15 |
- |
- |
- |
12 |
- |
1 |
- |
8 |
|
16 |
- |
- |
- |
12 |
3 |
1 |
10 |
8 |
|
17 |
- |
- |
- |
13 |
2 |
2 |
9 |
- |
|
17 |
2 |
- |
- |
14 |
- |
1 |
2 |
8 |
|
Seite
24 Ortsmaß Freiheit Hörde (Streichmaß) |
Berliner
Maß |
|
Malter |
Scheffel |
Viertel |
Kannen |
Malter |
Scheffel |
Viertel |
Kannen |
Mäßger |
|
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
8 |
10 |
|
|
|
2 |
- |
- |
- |
1 |
5 |
12 |
|
|
|
3 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
14 |
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
|
|
2 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
- |
- |
|
|
3 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
- |
- |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
|
2 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
- |
- |
- |
|
3 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
- |
- |
- |
|
4 |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
- |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
|
6 |
- |
- |
- |
4 |
2 |
- |
- |
- |
|
7 |
- |
- |
- |
5 |
1 |
- |
- |
- |
|
8 |
- |
- |
- |
6 |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
- |
- |
- |
6 |
3 |
- |
- |
- |
|
10 |
- |
- |
- |
7 |
2 |
- |
- |
- |
|
11 |
- |
- |
- |
8 |
1 |
- |
- |
- |
|
12 |
- |
- |
- |
9 |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
- |
- |
- |
9 |
3 |
- |
- |
- |
|
14 |
- |
- |
- |
10 |
2 |
- |
- |
- |
|
15 |
- |
- |
- |
11 |
1 |
- |
- |
- |
|
16 |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
- |
- |
- |
12 |
3 |
- |
- |
- |
|
18 |
|
|
|
13 |
2 |
- |
- |
- |
|
18 |
2 |
- |
- |
13 |
3 |
2 |
- |
- |
Die
drei obigen Tabellen sind Abschriften der Zahlenwerte der
Seiten-Nummern 15, 17 und 24 aus Jacobus von Wesel, Reductio der
Korn-Maassen im Herrzogthumb Cleve und Graffschafft Marck in die
neue Berlinische Korn-Maaß, Wesel 1714
|
Berliner
Korn- bzw. Hohlmaß |
nach
Jacobus von Wesel (1714) |
|
1
Malter = 219,856 Liter |
=
4 Scheffel |
|
1
Scheffel = 54,964 Liter |
=
4 Viertel |
|
1
Viertel = 13,741 Liter |
=
11 ½ Kannen |
|
1
Spint = 13,741 Liter |
=
11 ½ Kannen |
|
1
Metze |
=
2 7/8 Kannen = ¼ Spint |
|
1
Kanne |
=
16 Mäßger |
|