|
|
Jörgen Beckmann
Die wissenschaftliche Erforschung der optimalen
Nährstoffversorgung der Kulturpflanzen begann etwa in der Mitte
des 19.Jahrhunderts. So formulierte THÜNEN seine Ergebnisse 1842
über die Düngung mit Stallmist mit folgendem Satz: Jedes mehr
hinzugefügte Fuder Dung liefert einen immer geringeren Zuwachs
an Ertrag.
JUSTUS von LIEBIG, der den Ernteertrag in Abhängigkeit der
Mineralstoffversorgung bei Pflanzen erforschte, fand 1855
folgendes Gesetz: Der Ertrag wird vom Minimumfaktor begrenzt,
d.h. von dem in ungenügender Menge vorhandener Faktor. 1895
ergänzte er das vorgenannte mit den bis dahin gewonnenen
Erkenntnissen: Der Minimumfaktor ist um so stärker
ertragswirksam, je mehr die anderen Faktoren im Optimum sind.
Die hier genannten Gesetze von LIEBIG lassen sich symbolisch mit
einem Faß vergleichen, dessen Inhalt den Ernteertrag und deren
jeweiligen Daubenhöhen (Faßbretterlängen) die jeweilige Menge
der zur Verfügung stehenden für das Pflanzenwachstum im Boden
notwendigen Elemente, die in der unteren Tabelle aufgelistet
sind, darstellen. Hierbei wird deutlich sichtbar, daß die
niedrigste Daube
| |
|
|
Element |
Ionen-form |
optimale
Versorgung
ppm der Trockensubstanz |
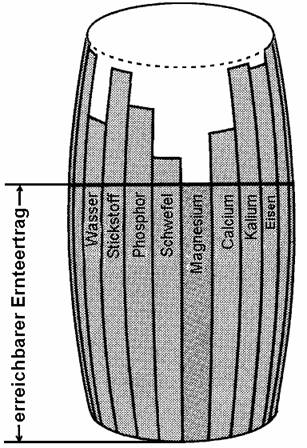 |
|
Hauptnähr-elemente |
Stickstoff |
NO3-
NH4+ |
30000 |
|
Phosphor |
H2PO4-
HPO42- |
4000 |
|
Schwefel |
SO42- |
4000 |
|
Kalium |
K+ |
30000 |
|
Calcium |
Ca2+ |
10000 |
|
Magnesium |
Mg2+ |
3000 |
|
Spurennähr-elemente |
Bor |
H2BO3-
HBO32- |
30 |
|
Molybdän |
MoO42- |
1 |
|
Chlor |
Cl- |
100 |
|
Eisen |
Fe2+
Fe3+ |
40 |
|
Mangan |
Mn2+ |
80 |
|
Zink |
Zn2+ |
50 |
|
Kupfer |
Cu2+
Cu+ |
10 |
|
|
Zusätzlich benötigen Pflanzen auch Wasser, Kohlendioxid,
Sauerstoff sowie Licht und Wärme. Wichtig ist auch der richtige
pH-Wert (Säuregrad) des Bodens, der auf die Verfügbarkeit der
Ionen der Haupt- und Spurennährelemente starken Einfluß nimmt.
Doch wie bewirtschafteten die hiesigen Bauern vor LIEBIG ihre
Äcker und wie groß waren ihre Ernten?
Aus dem Mittelalter sind uns
die Zwei- und später die Dreifelderwirtschaft bekannt. Bei der
Zweifelderwirtschaft wurden die Ackerflächen in zwei Schlägen
aufgeteilt, wobei der eine Schlag bebaut wurde und der andere
zur Bodenerholung brach lag. Ihr folgte die
Dreifelderwirtschaft, bei der die Ackerflächen in drei Schläge
aufgeteilt wurden. Die Bewirtschaftung der drei Schläge erfolgte
zyklisch abwechselnd mit Wintergetreide, Sommergetreide und
Brache. Doch trotz Brache und Ausbringung von Stallmist war
größtenteils der Nährstoffkreislauf der Ackerpflanzen auf den
Feldern stark beeinträchtigt. Gleiches galt auch für den Wald,
dem man das Holz als Bau- und Brennstoff sowie das herbstliche
Laub als Streu für die Haustiere entzog, ohne ihm die entzogenen
Nährstoffe in irgendeiner Form wieder zurückzugeben. In neuerer
Zeit wurden auf den Brachflächen auch Hülsenfrüchte angebaut,
weil man deren bodenverbessernde Wirkung zwar wahrgenommen
hatte, jedoch deren Ursache noch nicht kannte. Das Ernte-
Aussaatverhältnis war bei der Dreifelderwirtschaft etwa 10 : 1.
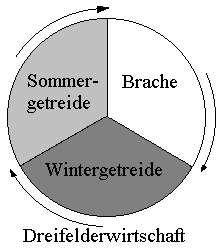
Wenn man berücksichtigt, daß im
Mittelalter der südliche Bereich Querenburgs bis hin zum
Kalwesrücken Bestandteil der Hevener Bauerschaft war, lassen
sich die drei Schläge in ihrer ungefähren Lage nachvollziehen,
und zwar der Querenburger- und Ölbachbereich, der
Ruhrkampbereich und der Bereich an der Voede- und
Universitätsstraße. Die „Arnsberger Höfe“ (Dönhof und Stemberg)
dürften aufgrund ihrer Außenlage und ihrer arrondierten
Ackerflächen eigene Schläge gebildet haben. Gleiches gilt auch
für die Kleinherbeder Höfe.
Die Frage auf die Ackerbewirtschaftung von 1824 beantworten die
vier landwirtschaftlichen Gutachter bzw. Taxatoren, und zwar
Rentmeister Ruhrmann zu Witten, der Bauer Buschmann zu
Hafkenscheid und die Schulten zu Limberg und zu Witten in zwei
Ermittlungen. Diese vier Bauern hatten im Jahre 1824 die
Aufgabe, für die königliche preußische Generalkommission zu
Münster die auf dem Grundbesitz der Hevener und Querenburger
Bauern haftenden Reallasten festzustellten, und zwar hier für
den zum Haus Herbede gehörenden „Hevener und Querenburger
Zehnten“, der Eigentum des Barons von Elverfeldt war. Diese
Aufnahme diente der Feststellung des gegenseitigen
Rechtsverhältnisses und der darauf folgenden Vollziehung der
Ablösung der grundherrlichen Rechte.
Die vier Taxatoren fanden bei den hiesigen Bauern einen
14-jährigen zyklischen Fruchtwechsel vor, der auf der folgenden
Seite tabellarisch dargestellt ist. Gleichzeitig schätzten sie
auch die zu erwartenden Erntenerträge bezogen auf die
Bodenbonität ab. Als Flächenmaß diente der Magdeburger Morgen (=
2553,224 m²), als Hohlmaß der preußische Scheffel mit 54,988
Liter gleich 16 Metzen und als Gewicht das Pfund mit 467,7
Gramm. Weiter führten sie auch die Kosten für einige
landwirtschaftliche Dienstleistungen an.
|
Jahr |
Behandlung des Ackers |
Flächennutzung
(Bericht I) |
Flächennutzung
(Bericht II) |
|
1. |
gedüngt |
½ reine Brache, ½ Rüben |
½ reine Brache, ½ Rüben |
|
2. |
|
Roggen |
Roggen |
|
3. |
|
Hafer |
Hafer |
|
4. |
gedüngt |
Gerste |
Gerste |
|
5. |
|
½ Weizen, ½ brauner Klee |
Klee |
|
6. |
|
Hafer |
Hafer |
|
7. |
gedüngt |
½ reine Brache, ½ Rüben |
Brache und Rüben |
|
8. |
|
Roggen |
Roggen |
|
9. |
|
Hafer |
Hafer |
|
10. |
gedüngt |
½ Erbsen, ½ Bohnen |
½ Erbsen, ½ Bohnen |
|
11. |
|
½ Weizen, ½ Roggen |
½ Weizen, ½ Roggen |
|
12. |
gedüngt |
¼ Sommersaat, ½ Kartoffeln,
¼ Flachs |
¼ Sommersaat, ½ Kartoffeln,
¼ Flachs |
|
13. |
|
Roggen |
Roggen |
|
14. |
|
Hafer |
Hafer |
Das obige Anbauzyklus-Schema dürfte sich einmal nach dem Bedarf
und zum anderen nach den bis dahin gesammelten
landwirtschaftlichen Erfahrungen mit der Fruchtfolge, mit
bestimmten Pflanzenkrankheiten und mit der gezielten Ausbringung
von Mist gerichtet haben, denn schon im Mittelalter wußte man „Wo
kein Mistus, da kein Christus“, was darauf hinweist, daß
dort, wo nicht gedüngt wurde, auch keine große Ernte zu erwarten
war.
Im Vergleich zu der davor praktizierten Dreifelderwirtschaft mit
1/3 Brache und 2/3
Bewirtschaftung hatte man 1824 eine wesentlich intensivere
Ackernutzung. Letztere wurde durch den Anbau der
bodenverbessernden Hülsenfrüchte (Leguminosae = Erbsen, Bohnen
und Klee) und durch den Anbau der Hackfrüchte (Kartoffeln und
Rüben) und die besseren Ackergeräte ermöglicht. Innerhalb von 14
Jahren lag jetzt jeder Acker nur 1 Jahr brach, wurde 5 mal mit
Mist gedüngt, weiter wurde er je einmal mit Gerste, Klee und
Rüben, ½ mal mit Weizen, Kartoffeln, Erbsen und Bohnen, ¼ mal
mit Sommersaat und Flachs sowie 4 mal mit Hafer und 3 ½ mal mit
Roggen bestellt. Doch beim Vergleich des
Ernte-Aussaatverhältnisses zu früheren Angaben aus dem 18.
Jahrhundert war nur eine leichte Steigerung zu bemerken. Hierbei
muß man ja auch berücksichtigen, daß die hiesigen Bauern ihr
Saatgut immer ihrer eigenen letztjährigen Ernte entnahmen, wobei
sich dann Inzuchteffekte, Pflanzenkrankheiten und tierische
Schädlinge sowie die Beimengungen von Unkrautsamen negativ auf
die Erntemengen der folgenden Jahre bemerkbar machten, so daß
kaum eine Steigerung der Erträge möglich war, denn mit den
Getreidehalmen konkurrierten Klatschmohn, Diesteln, Flughafer,
Kamille und viele andere Kräuter. Weiter ist anzumerken, daß ein
Teil der Äcker frisch gerodetem Markenwald entstammte.
Bedingt durch das schlechte Wegenetz mit unbefestigten Straßen
war zu jener Zeit jede Siedlung noch weitgehend allein auf sich
gestellt. In Siedlungen wie Heven, Herbede usw. war somit die
Bevölkerungszahl abhängig von der Produktion dieser Gebiete an
Nahrung und Energie, denn es fehlten noch schnelle
Transportmöglichkeiten wie die Eisenbahn, ausgebaute Straßen
usw., die diese lebenslimitierenden Stoffe aus Überschußgebieten
hätten schnell genug heranholen können. Die sogenannten
Hungerjahre von 1816-1818 zeugen davon.
Festgestellt hatte man zu jener Zeit, daß die Ernteerträge auf
Äckern der 2. bis 4. Klasse gesteigert werden konnten, wenn
diese zeitlich früher beackert und besät wurden. Flächen, deren
Bonitäten unter der 4. Klasse lagen, wie Flächen an Steilhängen
sowie im direkten Überschwemmungsbereich der Ruhr nutzte man als
Wald bzw. Dauerweiden.
Das frühere Aussäen bewirkt, so wie man heute weiß, eine
intensivere Bestockung der Wintergetreidepflanzen. Die
Bestockung des Getreides vollzieht sich bei den kürzer werdenden
Tagen, d.h. während dieser Zeit bilden sich Seitentriebe, die
dann bei länger werdenden Tagen zu Halmen mit Ähren auswachsen.
Um so früher im Herbst gesät wird, desto mehr Ähren erhält der
Bauer pro gesätes Korn. Doch das frühere Säen birgt auch Risiken
wie Fraß durch Tiere und starke Beeinträchtigungen durch
Krankheiten, Kälte und Schnee. Pro m² wurden etwa 300 Körner
gesät.
Setzt man die hier unten genannten Erntemengen und die weiter
hinten genannten Preise zu Grunde und subtrahiert das Saatgut
fürs kommende Jahr, so errechnet sich für einen hiesigen Hof mit
einer Ackerfläche von etwa 84 Morgen mit Äckern von
durchschnittlich 2. Klasse (Bodenbonität) für das Jahr 1824 ein
Bruttoeinkommen von etwa 1000 – 1100 Reichsthaler.
|
1 Magdeburger Morgen =
2553,224 m² |
Aussaat in Scheffel |
Ernte auf Acker I. Klasse an
Korn in Scheffel |
Ernte auf Acker II. Klasse an
Korn in Scheffel |
Ernte auf Acker III. Klasse an
Korn in Scheffel |
Ernte auf Acker IV. Klasse an
Korn in Scheffel |
|
Roggen |
1 - 0,875 |
9 |
7 |
6 |
5,25 |
|
Weizen |
1 - 0,875 |
9 |
7 |
6,125 |
5,25 |
|
Gerste |
0,875 |
14 |
12 |
10,5 |
9 |
|
Hafer nach Klee |
1,125 |
24 |
20 |
17,5 |
15,25 |
|
Hafer nach Roggen |
1,125 |
18-16 |
15-14 |
12,25 |
10,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Erbsen |
0,875 |
4,5 |
4 |
3,5 |
3 |
|
Bohnen |
1,5 |
10 |
8 |
7 |
6 |
|
Sommersaat |
0,125 |
5,5 - 5,25 |
5 |
4,25 |
3,75 |
|
Leinsaat=Flachs |
1,25 |
2,5 |
2 |
1,75 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kartoffel |
12 |
127,5 |
120 |
1/8
weniger
als die
II. Klasse
|
1/8
weniger
als die
III. Klasse
|
|
Rüben |
1/32 |
97,5 |
90 |
|
|
|
|
|
|
weißer Klee |
4,5 Pfund |
2400 Pfund |
2280 Pfund |
|
brauner Klee |
6 Pfund |
4600 Pfund |
4320 Pfund |
|
1 Scheffel
= 54,988 Liter = 16 Metzen |
|
1
Magdeburger Morgen =
2553,224
m² |
Strohernte vom Acker I. Klasse
in Pfund |
Strohernte vom Acker II.
Klasse in Pfund |
Strohernte vom Acker III. Klasse in Pfund |
Strohernte vom Acker IV.
Klasse in Pfund |
|
Roggen |
1710 |
1330 |
1160 |
1020 |
|
Weizen |
1530-1330 |
1190 |
955 |
780 |
|
Gerste |
1400 |
1200 |
1000 |
815 |
|
Hafer nach Klee |
1920 |
1600 |
1400 |
1225 |
|
Hafer nach Roggen |
1440 |
1200 |
1050 |
820 |
|
Erbsen |
1800 |
1800-1600 |
1400 |
1225 |
|
Bohnen |
2880-2800 |
2200-2160 |
1930 |
1660 |
|
Sommersaat |
550-525 |
500 |
430 |
340 |
|
Flachs |
70 |
60 |
50 |
45 |
|
Henden |
40 |
30 |
20 |
13 |
|
1 Pfund = 467,7 Gramm
1 Reichsthaler (Rthlr) = 30 Silbergroschen
(Sgr) = 360 Pfennig (Pfg) |
| |
|
pro 100 Pfund Stroh |
Preis in Sgr |
|
Roggenstroh |
15 - 14,5 |
|
Weizenstroh |
17 - 16,5 |
|
Gerstenstroh |
8 - 7,5 |
|
Haferstroh |
12 - 11,5 |
|
Erbsenstroh |
15 - 12,5 |
|
Bohnenstroh |
12 - 11,5 |
|
weißes Kleeheu |
20 |
|
braunes Kleeheu |
18 |
|
Rübsenstroh |
8 |
|
Sommersaatstroh |
7,5 |
|
Frucht |
Menge |
Sgr |
|
Rüben |
1 Scheffel |
6 |
|
Kartoffeln |
1 Scheffel |
12 |
|
Flachs* |
67,25 Pfund* |
6 |
|
Werg* (= Hanf) |
20 Pfund* |
8 |
|
*von einem Magdeburger
Morgen |
|
Wenn man nun berücksichtigt, daß der Bauer davon noch Steuern
zahlen und die grundherrlichen Abgaben leisten mußte, die
zusammen die Hälfte des Einkommens verschlangen, und zusätzlich
noch die Kosten für Acker- und Erntegeräte sowie für Zugtiere
und Hilfskräfte aufzubringen hatte, dürfte er bezogen auf die
Ernte ein Netto-Jahreseinkommen von etwa 300 Rthlr daraus
erzielt haben. Von einigen Flächen seines Hofes hatte er
zusätzlich noch den Hevener und Querenburger Zehnt zu
entrichten, die bei der obigen Auflistung noch nicht
berücksichtigt sind. Weiterhin trug der Bauer das gesamte Risiko
seiner Ackerfrüchte zwischen Aussaat bzw. Pflanzung und Ernte
sowie das Risiko der Kapitalisierung seiner Ernteprodukte, denn
der Grundherr und der Staat verlangten von ihm Geld und keine
Waren.
Die oben und weiter hinten genannten Tabellen ermöglichen einen
Einblick in die Fruchtpreise und in die Ernteverhältnisse der
jeweiligen Jahre. Die sogenannten Hungerjahre von 1816 – 1818
stechen durch ihre 5 – 6 fachhöheren Fruchtpreise deutlich
hervor. Weiter wird deutlich, daß damals die Preise für
Nahrungsmittel im Vergleich zur Entlohnung für Arbeiten in der
Landwirtschaft relativ hoch waren.
Die Tabelle am Schluß dieses Berichtes gibt uns einen Einblick
in das heutige Aussaat-Ernteverhältnis.
| |
|
Kosten pro Tag |
Rthlr |
Sgr |
Pfg |
|
1 Mannsperson mit Pferd und Karren |
1 |
16 |
2 |
|
1 Frauensperson zum Laden |
|
7 |
8 |
|
4 Fuder durch 2 Frauenspersonen zu bauen
(zu binden und in Stiegen aufzustellen)) |
|
3 |
10 |
|
Drescherlohn pro Morgen (ein Mann muß
täglich 100 Garben dreschen) |
|
3 |
9,6 |
|
|
Mußte früher eine Person ein Drittel ihres Einkommens für
Lebensmittelkäufe aufwenden, so reichen heute 10 %. Letzteres
wurde durch eine ernorme Steigerung der Ernterträge pro ha
möglich, wobei Züchtungen leistungsstarken Saatguts, modernes
Ackergerät und erforschte Anbautechniken, gezielte Düngung mit
Mineral- bzw. organischem Dünger sowie der Einsatz von
Beizmitteln, Insektiziden, Fungiziden und Herbiziden
einherliefen. Auf die Auswirkungen der Düngung
lebenslimitierender Mineralien wurde schon zu Beginn
eingegangen. Mit dem Beizen der Aussaat wird der Tierfraß
vermindert, mit den Insektiziden können schädliche Insekten
bekämpft werden, wie Blattläuse, Kartoffelkäfer usw.. Die
Fungizide dienen zur Beseitigung von Pilzbefall, wie Mehltau,
Getreiderost, Mutterkorn usw. und das Aufbringen der Herbizide
sorgt dafür, daß auf dem Acker nur das wächst, was der Bauer
gesät hat. Herbizide beseitigen also um den Standort
konkurrierende andere Pflanzenarten.
Die zukünftige Landwirtschaft, so ist jetzt schon vorherzusehen,
sorgt nicht nur für die Ernährung, sondern auch mittels
nachwachsender Rohstoffe für die Beschaffung der benötigten
Energie und hilft somit den Ausstoß des Kohlendioxids aus
fossilen Brennstoffen zu mindern. Anmerken möchte ich noch, daß
wir heute wesentlich mehr Geld für unsere Gesundheit als für
unsere Ernährung ausgeben, wobei uns die Medizin jetzt zwar
älter aber nicht vitaler werden läßt.
| |
Die amtlich registrierten Fruchtpreise des
Kornmarktes Witten wurden in den Amtsblättern wie folgt
genannt:
|
Witten |
Weizen
in Scheffel |
Roggen
in Scheffel |
Gerste
in Scheffel |
Hafer
in Scheffel |
|
|
R |
Sgr |
Pf |
R |
Sgr |
Pf |
R |
Sgr |
Pf |
R |
Sgr |
Pf |
|
1825 Okt. |
1 |
20 |
9 |
1 |
1 |
5 |
1 |
2 |
5 |
- |
23 |
9 |
|
1825 Juli |
1 |
10 |
8 |
- |
25 |
7 |
- |
22 |
2 |
- |
24 |
3 |
|
1825 Apr. |
1 |
5 |
9 |
- |
20 |
10 |
- |
20 |
5 |
- |
19 |
7 |
|
1824 Dez. |
1 |
6 |
10 |
- |
19 |
10 |
- |
19 |
9 |
- |
15 |
4 |
|
1824 Okt. |
1 |
6 |
5 |
- |
16 |
11 |
- |
17 |
4 |
- |
15 |
3,5 |
|
1824 Juli |
1 |
9 |
8 |
- |
18 |
6 |
- |
15 |
4 |
- |
16 |
10 |
|
1824 Apr. |
1 |
12 |
- |
- |
21 |
5,5 |
- |
19 |
2,5 |
- |
15 |
- |
|
1823 Dez. |
1 |
15 |
1 |
- |
26 |
8 |
- |
24 |
7 |
- |
18 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1818 Mai |
3 |
20 |
1 |
2 |
17 |
5 |
1 |
21 |
- |
1 |
4 |
9 |
|
1817 Mai |
7 |
3 |
- |
5 |
18 |
- |
4 |
7 |
- |
2 |
19 |
- |
|
1816 Dez. |
5 |
14 |
2 |
4 |
18 |
2 |
2 |
19 |
1 |
1 |
16 |
5 |
|
Witten |
Buchweizen
in Scheffel |
Kartoffeln
in Scheffel |
Heu
in Zentner |
Stroh
in Schock |
|
|
R |
Sgr |
Pf |
R |
Sgr |
Pf |
R |
Sgr |
Pf |
R |
Sgr |
Pf |
|
1825 Okt. |
1 |
6 |
11 |
- |
13 |
3 |
- |
17 |
9 |
5 |
16 |
- |
|
1825 Juli |
- |
- |
- |
- |
8 |
3 |
- |
9 |
9 |
3 |
4 |
2 |
|
1825 Apr. |
- |
- |
- |
- |
8 |
6 |
- |
13 |
7 |
4 |
9 |
3 |
|
1824 Dez. |
- |
- |
- |
- |
6 |
6 |
- |
10 |
10 |
3 |
15 |
3 |
|
1824 Okt. |
- |
- |
- |
- |
5 |
10 |
- |
10 |
1 |
3 |
2 |
- |
|
1824 Juli |
- |
- |
- |
- |
6 |
- |
- |
11 |
8 |
3 |
13 |
2 |
|
1824 Apr. |
- |
24 |
1 |
- |
7 |
- |
- |
17 |
- |
6 |
7 |
2,8 |
|
1823 Dez. |
- |
25 |
6 |
- |
9 |
8 |
- |
16 |
4 |
4 |
11 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1818 Mai |
2 |
21 |
2 |
- |
10 |
- |
- |
12 |
- |
12 |
- |
- |
|
1817 Mai |
- |
- |
- |
1 |
19 |
- |
1 |
10 |
- |
12 |
- |
- |
|
1816 Dez. |
5 |
5 |
10 |
1 |
12 |
8 |
1 |
12 |
8 |
- |
23 |
4 |
|
Amtsblatt 1825
Nr. 47, S.28-29 |
Maß |
Bochum
1824 Dez. |
|
Dortmund
1824 Dez. |
|
|
|
R |
Sgr |
Pf |
|
R |
Sgr |
Pf |
|
Weizen |
Scheffel (= 54,988 l) |
1 |
10 |
1,1 |
|
1 |
2 |
7,29 |
|
Roggen |
Scheffel |
- |
21 |
2 |
|
- |
19 |
8,85 |
|
Gerste |
Scheffel |
- |
20 |
4 |
|
- |
17 |
7,14 |
|
Hafer |
Scheffel |
- |
15 |
8 |
|
- |
13 |
9.43 |
|
Erbsen |
Scheffel |
- |
22 |
8,3 |
|
- |
21 |
11,14 |
|
Heu |
Zentner |
- |
12 |
2,7 |
|
- |
9 |
4,33 |
|
Stroh |
Schock |
3 |
20 |
10 |
|
2 |
24 |
1 |
|
Bier |
Quart (= 1,145 Liter) |
- |
1 |
1,3 |
|
- |
1 |
0,85 |
|
Brandwein |
Quart |
- |
5 |
2 |
|
- |
5 |
2,29 |
|
Schwarzbrot |
Pfund (= 467,7 g) |
- |
- |
3,3 |
|
- |
- |
3,5 |
|
Weißbrot |
4 Loth (= 62,3 g) |
- |
- |
1,625 |
|
- |
- |
- |
|
Rindfleisch |
Pfund |
- |
1 |
10,6 |
|
- |
1 |
8,29 |
|
Schweinefleisch |
Pfund |
- |
2 |
5,33 |
|
- |
2 |
2 |
|
Hammelfleisch |
Pfund |
- |
1 |
5,33 |
|
- |
1 |
7,5 |
|
Kalbfleisch |
Pfund |
- |
1 |
3 |
|
- |
1 |
4,6 |
|
Hafergrütze |
Metze (= 3,43 Liter) |
- |
1 |
2 |
|
- |
4 |
1,5 |
|
Graupen |
Metze |
- |
5 |
2 |
|
- |
5 |
0,75 |
|
Reis |
Pfund |
- |
3 |
5,33 |
|
- |
3 |
2 |
|
Speck |
Pfund |
- |
3 |
8 |
|
- |
3 |
2,29 |
|
Kartoffeln |
Scheffel |
- |
6 |
11 |
|
- |
6 |
3 |
|
Butter |
Pfund |
- |
4 |
1,25 |
|
- |
3 |
10 |
|
Ferkel
1 |
|
1 |
9 |
6,86 |
|
|
|
|
|
Getreideart 4 |
Aussaat |
Aussaatmenge kg/ha |
Ernte |
Erntemenge
kg/ha |
Anmerkungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wintergerste |
September |
80 –
120 |
Juli |
6000 -
9000 |
je
früher gesät, desto größer die Bestockung aber je größer
der Krankheitsbefall |
eiweißreich, standfest, um 30% ertragreicher als
Sommergerste |
|
Sommergerste |
März-April |
80 |
August |
4000 -
6000 |
Vorsicht mit hoher N-Düngung |
eiweißarm, Braugerste |
|
Roggen |
Sept. – Nov. |
60 - 100 |
August |
5000 -
8000 |
geringe
Bodenansprüche |
kann
mehrmals hintereinander gesät werden |
|
Weizen |
Sept. -
Dez. |
120 -
200 |
August |
7000 -
10000 |
hohe
Bodenansprüche,
mindestens über 45 Bodenpunkte, anspruchsvollste
Getreideart |
viel
Eiweiß, daher viel N-Düngung |
|
Sommerweizen |
März -
April |
|
August |
6000 -
8000 |
wie
Winterweizen |
ist
eiweißreich,
hat
bessere Backqualität |
|
Hafer |
März |
60 - 70 |
August |
5000 -
7000 |
geringe
Bodenansprüche, stellt höhere Ansprüche an Wasser als
Roggen |
gute
Vorfrucht für Weizen |
|
Raps
Hybridsorte |
bis
20.Aug.
bis 3.Sept. |
2,5 - 3 |
August |
3000 –
4000
4000 -
5500 |
mittlere Ansprüche an den Boden |
bedarf
Fruchtfolge
40 – 42
% Öl |
|
Mais |
April |
|
Oktober |
8000 -
10000 |
geringe
Ansprüche an den Boden, besser auf leichten Böden |
kann
mehrmals hintereinander gesät werden, Hirse verbreitet
sich dabei als Konkurenzpflanze |
|
Kartoffel |
April |
1800 |
Sept.-Okt. |
30000 |
geringe
Bodenansprüche |
bedarf
Fruchtfolge |
|
Zuckerrüben |
März -
April |
(100000 Samen) |
Okt.-
Dez. |
40000-50000 |
höhere
Bodenansprüche |
Abstand
18 cm, Reihenabstand 42 cm, 100000 Pflanzen / ha |
|
|
|